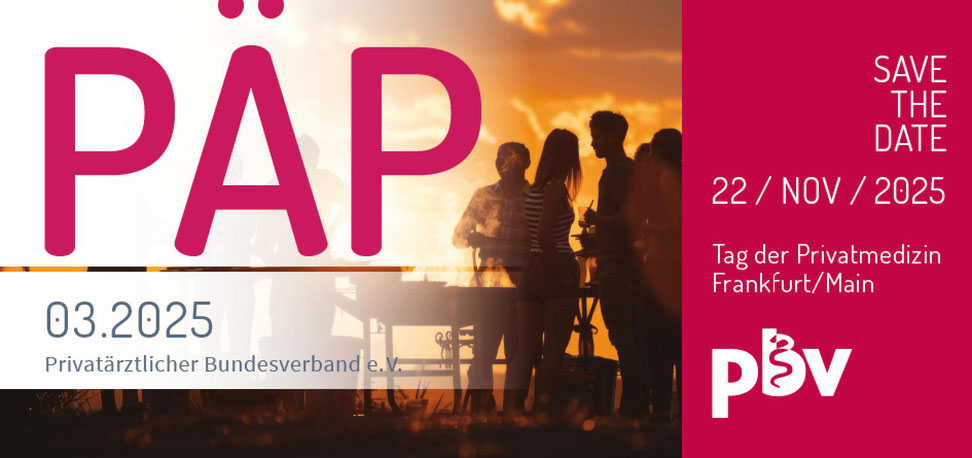PBV-Vorstandsmitglieder
Dr. med. Norbert A. Franz, Vorsitzender
Prof. Dr. med. Markus Hambek, 2. Vorsitzender
Dr. med. Christoph Gepp, 2. Vors./Schatzmeister
Dr. med. Thomas P. Ems, Geschäftsführer
Editorial
Liebe Mitglieder,
am 17. Mai 2025 fand unsere Jahreshauptversammlung in Frankfurt am Main statt. Erfreulicherweise konnten wir mehr Anmeldungen denn je verzeichnen, sodass der Raum (aufgrund von Umbaumaßnahmen im
Hotel Meridian mussten wir diesmal ausweichen) bis zum letzten Platz gefüllt war.
Im Fortbildungsteil fanden die Themen Eisenmangelmanagement, Adipositasbehandlung, aktuelle Steuer- und Rechtsfragen großen Anklang im Auditorium. Da keine zwei Wochen später der Deutsche
Ärztetag einen Beschluss zur sogenannten konsentierten GOÄ fasste, war im politischen Teil unserer Fortbildung dies ebenfalls Thema. Die Rückmeldungen der Mitglieder waren erwartbar heterogen.
Und so haben wir nach dem Deutschen Ärztetag auch eine Reihe zurecht kritischer Nachrichten der Mitglieder erhalten.
Wie auch schon im Rahmen der Jahreshauptversammlung kommuniziert, möchten wir anmerken, dass wir als fachübergreifender Verband uns zu grundsätzlichen Fragen (insbesondere im Paragrafenteil der
GOÄ) einbringen konnten (und dies zum Teil auch erfolgreich), jedoch nicht zu einzelnen fachspezifischen Ziffern. Dies war und ist weiterhin Aufgabe der Fachgesellschaften, die wir gern bei
Bedarf unterstützen. Daher bitten wir Sie auch auf diesem Wege um Verständnis, sich im Falle von, aus Ihrer Sicht, Fehlbewertungen einzelner Leistungsziffern, an die GOÄ-Fachausschüsse Ihrer
jeweiligen Fachgesellschaft (bzw. Ihres Berufsverbandes) zu wenden. Auch wenn der Beschluss des Ärztetages das Ende der Konsentierungsphase bedeutet, so ist diese GOÄ-Vorlage immer noch nur eine
Empfehlung und nicht die endgültige Rechtsverordnung.
In dieser Ausgabe finden Sie drei informative Artikel zum Thema Steuern, Praxismanagement und Recht (ärztlicher Bereitschaftsdienst). Wir wünschen Ihnen viele Freude bei der Lektüre.
Ihr Vorstand
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der PÄP auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.


Marc Däumler
Marc Däumler ist Senior-PR-Berater und Inhaber der Agentur excognito, einer
Kommunikationsagentur für Healthcare und Lifestyle in Berlin.
Praxismanagement
Der richtige Name für meine Praxis
Im Idealfall behalten Sie den Praxisnamen genau so lange, wie Ihren Familiennamen, und zwar für immer. In diesem Artikel geht es um die strategische Namensfindung aus PR- und
Marketingsicht, das heißt: Welche Eigenschaften sollte ein guter Praxisname haben, und wie kreiert man den am besten? Im Vorfeld sollten Sie mit der Ärztekammer klären, welche Begriffe (Beispiel
„Zentrum für ...“) Sie verwenden können, bevor es losgeht, und ein Jurist sollte sich vor der Anmeldung beim Patentamt den Namen ansehen. Idealerweise gibt der perfekte Praxisname schon einen
Hinweis darauf, was Sie fachärztlich anbieten, die Domain ist zudem passend zum Namen 1 : 1 frei, es bestehen auch keine Social-Media-Kanäle mit dem Namen, und beim Patentamt ist dazu nichts
eingetragen.
Zahnarztpraxis Meier? Orthopädische Praxis Schulze und Schmidt? Augenarzt Schneider und Kollegen? Kardiologiepraxis am Bahnhof?
Üblich in Deutschland sind Praxisnamen, die mit der Fachrichtung vorne wie Hautarzt oder Urologe beginnen und mit dem Familiennachnamen (manchmal auch dem Praxisstandort) enden, wie Meier,
Müller, Schulze oder „am See“ oder „am Bahnhof“. Das hat Tradition und Vorteile. Erstens ist die Ärztin oder der Arzt die Marke, also der Familienname ist die Marke, denn diese Person behandelt
die Patientinnen und Patienten. Zweitens ist so immer sofort klar, welche Fachrichtung eine Praxis anbietet, und es erleichtert drittens die Suche der Patienten nach dem Arzt oder der Ärztin,
egal, ob es eine Hautarztpraxis ist oder Frau Dr. Müller oder der Standort am Bahnhof. In einem abgelegenen Vorort oder kleinen Dorf irgendwo abseits der großen Städte funktioniert das auch noch
sehr gut bei der Namensnennung bei Praxisgründung. Aber was ist, wenn ein Herr Dr. Müller mit Praxis für Allgemeinmedizin eine Praxis in Berlin oder Hamburg eröffnen will als Praxis Müller? Da
wird es schon jemanden mit dem Namen geben. Den Namen „Praxis Müller“ zum Beispiel gibt es laut ChatGPT schon tausendfach in Deutschland. Was ist, wenn die Praxis mal umzieht, also weg vom „am
Bahnhof“ und hin zum „am Weiher“? Was ist, wenn es mal mehrere Standorte gibt, was sich ja durchaus so entwickeln kann. Und was, wenn sich das Leistungsspektrum differenziert erweitert, zum
Beispiel die Ästhetische Medizin hinzukommt oder weitere Partner auch weitere Fachrichtungen mitbringen, zum Beispiel ein Internist mit dem Schwerpunkt Diabetologie kommt in die Praxis für
Allgemeinmedizin? Und was, wenn diese Ärzte mal Partner werden, die einen anderen Nachnamen haben und gleichberechtigt sind und auch genannt werden wollen? Oder was, wenn geheiratet wird und sich
der Name ändert (im üblen Fall kann es auch eine Scheidung sein mit Namensänderung). Oder. Oder. Oder. Und was dann?
Ein Praxisname muss also das Spektrum der möglichen Entwicklungen aushalten können. Heute ist die Außendarstellung eben nicht mehr das Praxisschild und der Telefonbucheintrag, sondern die Website
mit Domain, die Google-Auffindbarkeit, das Google-Business oder ein Social-Media-Kanal. Und wenn sich da ein Praxisname ändert oder der Instagram-Kanal ganz anders klingt, dann wird es kniffelig.
Und woran viele erst später denken: Wird die Praxis mal verkauft? Schön, wenn der etablierte Praxisname dann bestehen bleiben kann, denn der kann einen hohen Wert haben. Aber Dr. Müller will
bestimmt nicht die Praxis Dr. Schneider mit diesem Namen weiterführen.
Die wichtigsten Eigenschaften eines guten Praxisnamens
Ein Name ist dann gut, wenn man sich ihn leicht merken kann, fertig. Komplizierte, akademische Namen sind ungeeignet, denn wenn Sie möchten, dass Sie weiterempfohlen werden, brauchen Sie einen
Namen, den sich jede Patientin und jeder Patient gut merken kann, nur dann können die Ihre Praxis namentlich auch empfehlen. Ganz einfach.
Zudem muss der Name einfach einzutippen sein, zum Beispiel bei Google, was bei langen oder auch englischen Namen manchmal schwierig wird, da sich das „Hören“ und „Schreiben“ schon deutlich
unterscheiden können.
Der Praxisname soll im Idealfall, und den streben wir an, gleich sein wie Ihre Praxisdomain (also der Name Ihrer Website). Wenn die Praxis mit dem Namen Fortumed eine Website mit der Domain
„Schöne-Haut-Heute.de“ hat, weiß niemand, ob es sich um die gleiche Praxis handelt. Die Domain soll also passend zum Praxiswunschnamen frei sein. Und am Ende soll er natürlich nicht als Name beim
Patentamt schon angemeldet sein.
Jede Fachrichtung hat eigene Anforderungen
Was haben Sie vor? Eine Praxisgründung ausschließlich für die ästhetische Chirurgie? Oder eine Zahnarztpraxis von A bis Z, also zudem auch Kinderzahnarzt, MKG, Implantologie, Kieferorthopädie?
Eine neue Praxis für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Medizin? Das sind alles völlig unterschiedliche Zielgruppen. Bei einer Praxis für ästhetisch-plastische Chirurgie empfiehlt
sich ein Name, der direkt etwas mit dem Begriff Ästhetik (das wird schwierig, denn da gibt es schon viele auf dem Markt) oder indirekt zu tun hat – es muss am Namen erkennbar sein, dass es hier
um Ästhetik geht. Eine Zahnarztpraxis mit umfangreichem Portfolio sollte sich nicht klein machen und nur als Zahnarztpraxis auftreten; hier macht ein konstruierter Name Sinn, der etwas mit dem
Begriff Zähne zu tun hat („denta“ als Basisbegriff empfiehlt sich beispielsweise). Wer ganzheitliche Medizin anbietet, sollte sich beim Begriff nicht auf ein Organ oder Körperteil fokussieren,
denn das widerspricht sich natürlich. Es ist also eine strategische und zugleich kreative Aufgabe.
Tipps bei der Namensfindung
Nehmen Sie sich einen Zettel (Zettel ist besser als ein Worddokument), und nun teilen Sie diesen Zettel in zwei Spalten, links und rechts. Links schreiben Sie die Vorgaben, also was dieser Name
in Ihren Augen erfüllen muss, zum Beispiel: ohne Familienname, nicht englisch, nicht lang, als medizinische Institution erkennbar, Begriffe zu Ihrer Fachrichtung (zum Beispiel Ästhetik oder
Zahnarzt oder Ganzheitliche Medizin), keine Standortangabe, und für den privatmedizinischen Sektor wäre etwas „Edles“ als Name angebracht etc. Auf der rechten Seite kommt der kreative Teil, das
Brainstorming, also welche Begriffe (nicht Namen!) fallen Ihnen dazu ein. Sind Sie Dermatologe, dann schreiben Sie alle Begriffe auf, die mit Ihrer Arbeit zu tun haben, also „Haut“, „Flecken“,
„Laser“, „Falten“, „Beauty“, Krankheiten und so weiter. Schreiben Sie alles auf.
Jetzt erstellen Sie eine neue Tabelle mit fünf Spalten. Das kann Word oder Excel sein. Links kommt der Name hinein, der Ihnen auf Basis des Worddokumentes einfällt. Zum Beispiel „Fortumed“ oder
„Schöne-Haut-Heute“.
In der zweiten Spalte daneben kommt der Google-Check, also geben Sie diesen Namen bei Google ein und schauen Sie, ob es dazu Treffer gibt. Arbeiten Sie hier auch mit Varianten, die Sie alle
gleich auch in die erste Spalte untereinander aufschreiben, also ein Buchstabe mehr, mal einen Vokal austauschen. Es gibt schon eine Praxis oder Firma mit dem Namen? Dann geht das Kreieren
weiter. Das wird am Anfang ernüchternd sein. Kopf hoch!
In die dritte Spalte kommt, falls der Name bei Google keine Treffer anzeigt, ob die Domain dazu noch frei ist. Dazu wählen Sie einen der vielen kostenlosen sogenannten „Domain-Checker“. Ist die
Domain frei, sehr gut, notieren Sie es. Ist die Domain vergeben, keine Sorge: Geben Sie diese Domain ein, im Internet, also beispielsweise www.fortumed.de oder www.Schoene-Haut-Heute.de, denn
manchmal werden Domains auch zum Kauf angeboten. Immer noch alles verfügbar?
Dann checken Sie in der vierten Spalte, ob es bei Facebook oder Instagram schon einen Account damit gibt. Alles frei?
Danach kommt die fünfte Spalte – und jetzt wird es spannend – und zwar der Check beim Patentamt unter www.register.dpma.de. Kein Eintrag vorhanden? Im Idealfall haben Sie jetzt Ihren Namen
gefunden.
Name vergeben, was nun?
Was tun, wenn der gut passende Name vergeben ist, ganz gleich ob als Domain oder bei Facebook oder beim Patentamt? Wenn Sie die Inhaber ausfindig machen können – bei Facebook reicht zum Beispiel
eine Nachricht über Messenger, beim Patentamt können Sie die Rechteinhaber auch schnell entdecken –, dann fragen Sie nach, ob der Name verkäuflich ist.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Manche Namen und Begriffe fühlen sich perfekt an, aber genau dann ist eine rechtliche Prüfung sinnvoll oder eine Vorauskunft bei der Ärztekammer. Praxisnamen, die ein Heilversprechen in sich
tragen, wie „Heilpraxis“ oder „Schmerzfrei“, sind zwar attraktiv aus PR-Sicht, aber leider juristisch problematisch. Das Gleiche gilt für Begriffe wie „Zentrum“, „Praxisklinik“, „Institut“,
„Praxisgemeinschaft“ oder „Gemeinschaftspraxis“. Da sind individuelle Prüfungen eine Voraussetzung.
Wer hilft mir, wenn ich nicht selbst kreativ werden will?
Tatsächlich gibt es PR-Agenturen oder Werbeagenturen, die solche Dienste anbieten. Da es sich um eine kreative Arbeit handelt, die manchmal (zu mindestens theoretisch) in 60 Minuten zum Erfolg
führt und manchmal einige Wochen braucht, ist ein Basissockel als Festpreis üblich, verbunden mit einer Anzahl von Vorschlägen. Und dann, falls noch nichts gefunden wurde, was dem Kunden gefällt,
kann über eine weitere Festpreisbasis verhandelt werden mit einer festen Anzahl an Vorschlägen, oder es wird auf Stundenbasis weitergearbeitet, wenn man schon dicht dran ist.
Fazit
Einen eigenen Namen für die Praxis zu finden, kann Spaß machen, aber auch (viel) Zeit in Anspruch nehmen. Wer selbst nicht kreativ ist, sollte eine entsprechende Agentur damit beauftragen.
Haben Sie hierzu Fragen?
Sprechen Sie mich jederzeit an unter: marc.daeumler@excognito.de


Janine Peine
Janine Peine ist Steuerberaterin und Fachberaterin Gesundheitswesen (IBG/HS Bremerhaven) im bundesweiten Steuerberaterverbund ETL ADVISION.
Recht und Steuern
Die neue Kleinunternehmerregelung ab 2025 – was sich für Ärzte ändert
Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Regelung zur Umsatzsteuer für sogenannte Kleinunternehmer. Diese Änderung wurde mit dem Jahressteuergesetz 2024 beschlossen und betrifft auch
selbstständige Mediziner, wenn sie neben ihrer Heilbehandlung auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen. In diesem Artikel erklären wir, was sich geändert hat, welche Chancen und Risiken
die neue Regelung bringt und worauf Unternehmer im Gesundheitswesen achten sollten.
Was ist die Kleinunternehmerregelung?
Wer nur geringe umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt, kann die Kleinunternehmerregelung gemäß. §19 UStG nutzen, damit auf diese Umsätze keine Umsatzsteuer entsteht. Im
Gegenzug darf man aber auch keine Vorsteuer abziehen – also keine Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückbekommen, die man selbst für Einkäufe bezahlt hat, die im Zusammenhang mit den sonst
umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen stehen.
Das ist seit 2025 neu
Zum 1. Januar 2025 wurden die Regeln für Kleinunternehmer geändert. Das Ziel: die deutsche Regelung an das EU-Recht anzupassen und gleichzeitig eine Vereinfachung zu
erreichen.
Eine wichtige Neuerung ist die Anhebung der Umsatzgrenzen: Ab 2025 dürfen maximal 25.000 Euro an steuerpflichtigen Umsätzen erzielt worden sein (bisher: 22.000 Euro), um die
Kleinunternehmerregelung nutzen zu können. Im aktuellen Jahr darf der Umsatz maximal 100.000 Euro betragen (bisher: 50.000 Euro). Es zählt dabei der tatsächliche Umsatz im laufenden Jahr – nicht
mehr nur eine Schätzung.
Die Umsatzgrenzen beziehen sich jetzt immer auf Nettobeträge, also ohne Umsatzsteuer. Umsatzsteuerfreie Umsätze, wie Umsätze aus Heilbehandlungen, werden in die Umsatzgrenze nicht
einbezogen.
Neu ab 2025 ist insbesondere, dass bei Überschreiten der 100.000-Euro-Grenze im laufenden Jahr die Umsatzsteuerpflicht bereits ab dem nächsten Monat eintritt – nicht wie bisher erst ab dem
nächsten Jahr. Das bedeutet, dass die Kleinunternehmergrenze in der Buchführung regelmäßig überwacht werden sollte.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Facharzt für Dermatologie führt neben therapeutischen Leistungen auch ästhetische Behandlungen durch, die nicht von der Umsatzsteuer befreit sind. 2024 lag der
Jahresumsatz aus den ästhetischen Leistungen bei 26.000 Euro. Im Jahr 2025 erzielt er Einnahmen daraus von 29.155 Euro – die teilen sich auf in 24.500 Euro Umsatz und 4.655 Euro
Umsatzsteuer.
Da die 24.500 Euro unter der neuen Kleinunternehmergrenze von 25.000 Euro liegen, kann der Arzt ab 2026 wieder Kleinunternehmer sein – wenn er das möchte. Er sollte aber mit seiner Steuerberatung
klären, ob das sinnvoll ist.
Achtung bei weiteren Einnahmen außerhalb der Praxis!
Bei der Umsatzsteuer wird der Arzt mit allen seinen Umsätzen insgesamt betrachtet. Das bedeutet, dass in die Berechnung der Umsatzgrenze auch Umsätze einzurechnen sind, die möglicherweise
außerhalb der Praxis erzielt werden. Das können Mieteinnahmen aus einer Ferienwohnung sein oder bestimmte Vergütungen aus ehren- und hauptamtlichen Tätigkeiten.
Auswirkungen für Ärzte
Heilbehandlungen sind in der Regel von der Umsatzsteuer befreit. Viele Ärzte merken deshalb von der Regelung gar nichts – solange sie nur steuerfreie Leistungen anbieten.
Anders sieht es aus, wenn sie auch steuerpflichtige Leistungen anbieten.
Solche Leistungen sind beispielsweise:
• Privat- und Selbstzahlerleistungen ohne medizinische Notwendigkeit
• Schönheitsbehandlungen
• Verkauf von medizinischen Produkten oder Nahrungsergänzungsmitteln
• Honorare für Coachings oder Vorträge
• Bestimmte Gutachtenhonorare
In diesen Fällen kann die neue Kleinunternehmerregelung eine Rolle spielen – und neue Chancen oder auch Risiken bringen.
Vor- und Nachteile der Kleinunternehmerregelung
Vorteile:
• Keine Umsatzsteuer auf Rechnungen – einfachere Abrechnung
• Weniger Bürokratie und weniger Steuererklärungen
• Günstiger Preis für Privatkunden, weil keine Umsatzsteuer aufgeschlagen wird
Nachteile:
• Kein Vorsteuerabzug – wer Geräte oder Material einkauft, bekommt die Umsatzsteuer nicht (anteilig) angerechnet.
Gut zu wissen – Wechsel zwischen Regelbesteuerung und Kleinunternehmer ist möglich
Wer bisher die Regelbesteuerung genutzt hat, aber unter den Umsatzgrenzen der Kleinunternehmer-regelung liegt, kann zur Kleinunternehmerregelung zurückwechseln – wenn die
Voraussetzungen erfüllt sind. Aber: Dann muss eventuell Vorsteuer zurückgezahlt werden, die man in den Vorjahren erhalten hat. Das nennt man „Vorsteuerberichtigung“.
Umgekehrt kann ein Kleinunternehmer auch auf die Regel verzichten – also zur Umsatzsteuer optieren. Das kann sinnvoll sein, wenn hohe Investitionen für den nicht medizinischen Praxisbereich
geplant sind, weil dann die Vorsteuer geltend gemacht werden kann.
Wichtig: Dieser Verzicht gilt für mindestens fünf Jahre und muss ans Finanzamt gemeldet werden – bis zum Ende der Steuererklärungsfrist..
Fazit
Die neue Kleinunternehmerregelung bringt mehr Flexibilität und höhere Umsatzgrenzen – gerade für Heilberufe mit zusätzlichen
Angeboten neben der klassischen Behandlung. Für viele Ärzte kann das attraktiv sein – aber es lohnt sich, genau hinzusehen und eine Steuerberatung hinzuzuziehen.
Denn wer zu früh oder zu spät handelt, kann schnell Geld verlieren – durch entgangene Vorsteuer, falsche Rechnungen oder unnötige Steuerpflichten. Wer dagegen gut plant, kann von der neuen
Regelung profitieren – und sich den Aufwand mit der Umsatzsteuer sparen.
Haben Sie hierzu Fragen?
Sprechen Sie mich jederzeit an unter: janine.peine@etl.de



Matthias Hauer und Dr. med. Christoph Gepp
Matthias Hauer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in Bad Nauheim. Christoph Gepp ist 2. Vorsitzender und
Schatzmeister im PBV und Allgemeinmediziner in Darmstadt.
Privatmedizin aktuell
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen
Außer der GOÄ neu beschäftigt kein Thema in Deutschland privat tätige Ärztinnen und Ärzte aktuell mehr: Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen). Umso
erstaunlicher ist es, dass kaum bekannt ist, dass sich der Privatärztliche Bundesverband (PBV) bei diesem Thema aktiv für die Interessen seiner Mitglieder einsetzt und diese vertritt. Wir wollen
Sie heute an dieser Stelle in kurzer Form über das Wichtigste zu diesem Thema informieren.
In nahezu allen Bundesländern wird der ärztliche Bereitschaftsdienst inzwischen gemeinsam von Kassenärztlichen Vereinigungen und Ärztekammern organisiert. Nach aktuellem
Kenntnisstand bilden lediglich Hamburg und Rheinland-Pfalz eine Ausnahme, dort existiert keine gemeinsame Bereitschaftsdienstordnung. Folgerichtig werden Vertrags- und Privatärzte in den meisten
Bundesländern gleichermaßen zur Teilnahme (Dienste) und Finanzierung eines gemeinsam organisierten Bereitschaftsdienstes herangezogen.
Unterschiedliche Gesetzgebungszuständigkeiten
Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Ärztekammern und Kassenärztliche Vereinigungen als öffentlich-rechtliche Körperschaften unterschiedliche gesetzliche Aufträge haben. Die
gesetzlichen Zuständigkeiten für die Zuweisung dieser Aufgaben beruhen nicht auf einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage. Eine Differenzierung bei der organisatorischen Umsetzung erfolgt meist
auch nicht. Die unterschiedlichen Gesetzgebungszuständigkeiten sind der Schlüssel zum Verständnis des Rechtsproblems, das sich im Bereitschaftsdienst offenbart.
Den Ärztekammern werden Aufgaben und Befugnisse auf der Grundlage von Landesgesetzen zugewiesen, namentlich die jeweiligen Heilberufsgesetze oder Kammergesetze der einzelnen Bundesländer. Die
Aufgaben und Befugnisse der KVen werden durch Bundesrecht, namentlich durch das SGB V, zugeteilt – und zwar auf Grundlage der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes aus
Art. 74 Abs. 1 Ziff. 12 GG (Recht der Sozialversicherung). Konkurrierende Gesetzgebung bedeutet, dass die Länder das Recht zur Gesetzgebung haben, sofern nicht der Bund von seinem
Gesetzgebungsrecht Gebrauch macht. Macht der Bund von seinem konkurrierenden Gesetzgebungsrecht Gebrauch, sind die Länder mit eigenen Regeln ausgeschlossen, egal ob diese vorher bereits in Kraft
waren, die bundesrechtliche Regelung wiederholen oder diese weiter ausgestalten. Die landesrechtliche Kompetenz ist in derartigen Fällen eine Residualkompetenz, die im Wege der
Subtraktionsmethode zu bestimmen ist.
Dies hat zum Beispiel das Hessische Landessozialgericht sehr instruktiv in seinem Urteil vom 25.01.2023 – L 4 KA 17/22 erläutert. Das Urteil können Sie natürlich über die Geschäftsstelle des PBV
anfordern. Die Entscheidung ist übrigens auch rechtskräftig (!!), was gern überlesen wird.
Allerdings wurden andere Entscheidungen des Hessischen Landessozialgerichtes in Parallelverfahren vom 6. Senat des Bundessozialgerichtes in den Urteilsgründen teilweise abgeändert. Die
Rechtsprechung ist uneinheitlich und im Fluss.
Freiwilligkeitsprinzip
Die Beteiligung von Nichtkassenärzten am Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigungen ist aktuell in § 75 Abs. 1b S. 5 SGB V geregelt. Nach dieser Regelung sind
„… nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende zugelassene Krankenhäuser und Ärzte, die aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in den Notdienst
einbezogen sind, zur Leistungserbringung im Rahmen des Notdienstes berechtigt und nehmen zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil“.
Der Bund hat hiermit ein Freiwilligkeitsprinzip auf Grundlage einer Vereinbarung geregelt, auf die teilnahmewillige Ärzte ein Anrecht haben. Dies steht in diametralem Widerspruch zur Einbeziehung
nicht vertragsärztlich tätiger Ärzte in den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst einer Kassenärztlichen Vereinigung gegen deren Willen auf Grundlage landesrechtlicher Regelungen bzw. ohne die
Möglichkeit einer Vereinbarung.
Da der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis – nach unserer Auffassung – abschließend Gebrauch gemacht hat, sind die Länder von der Gesetzgebung ausgeschlossen. Deshalb sind wir
auch der Auffassung, dass eine verpflichtende Einbeziehung von Privatärzten in den Bereitschaftsdienst der KVen auf Grundlage landesrechtlicher Regelungen ohne Vertrag nicht der Verteilung der
Gesetzgebungszuständigkeiten des Grundgesetzes entspricht.
Das Bundessozialgericht hat in mehreren Urteilen vom 25.10.2023 festgehalten, dass die Regelung des § 75 Abs. 1b S. 5 SGB V nicht abschließend ist und die Länder, in dem konkreten Fall Hessen,
daher trotzdem grundsätzlich befugt seien, eine verpflichtende Einbeziehung zu regeln. Die verfassungsrechtliche Fragestellung ist damit aus Sicht der Sozialgerichtsbarkeit erledigt. Für die
Betroffenen ist sie das keineswegs.
Derzeit sind weitere Klagen, etwa 20, im Zusammenhang mit der Einbeziehung von Privatärzten in den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst bei verschiedenen Gerichten rechtshängig, unter anderem
in Nordrhein, Westfalen-Lippe und – ein weiteres Mal – in Hessen. Diese Prozesse werden wieder von Rechtsanwalt Matthias Hauer aus Bad Nauheim geführt, der bekanntermaßen schon früher viele
Privatärzte gegen die Kassenärztliche Vereinigung Hessen erfolgreich vertreten hat. Bei den Verfahren handelt es sich um Pilotverfahren, bei denen neben Mitgliedern des PBV auch der Vorstand als
Kläger auftritt.
Die Rechtslage lässt viel Bewertungsspielräume, was gerade in jüngster Zeit dazu geführt hat, dass Instanzgerichte anders entschieden haben als das Bundessozialgericht. Durch die Initiative des
Verbandes kommt Bewegung in die Sache.
Fazit
Der Privatärztliche Bundesverband unterstützt Sie in Verfahren aktiv, um für uns alle eine Freistellung vom Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst zu erreichen. Diese Ansätze geben Anlass zur Hoffnung, diesmal unsere – völlig berechtigten, aber immer ignorierten – Rechte durchzusetzen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den privatärztlichen Bundesverband (PBV) unter: sekretariat@pbv-aerzte.de

Sonja Schroeter
Ihre Ansprechpartnerin bei allen
Fragen rund um den PBV
Kontakt zum PBV
Sonja Schroeter
Telefon: +49 6151 5012200
Mobil: +49 152 02146178
Fax: +49 6151 22813
sekretariat@pbv-aerzte.de
Sprechzeiten
Montag von 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch von 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr
Mitgliedschaft
Jetzt mitgestalten!
Kommen Sie zu uns, wenn Sie sich mit unseren Aufgaben und Zielen identifizieren können und Sie ebenso wie wir von der Notwendigkeit einer schlagkräftigen Interessenvertretung für Privatärztinnen
und Privatärzte überzeugt sind.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 165,00 EUR pro Jahr und beinhaltet z. B. die Teilnahme am „Tag der Privatmedizin“. Weitere Vorteile für
Mitglieder!